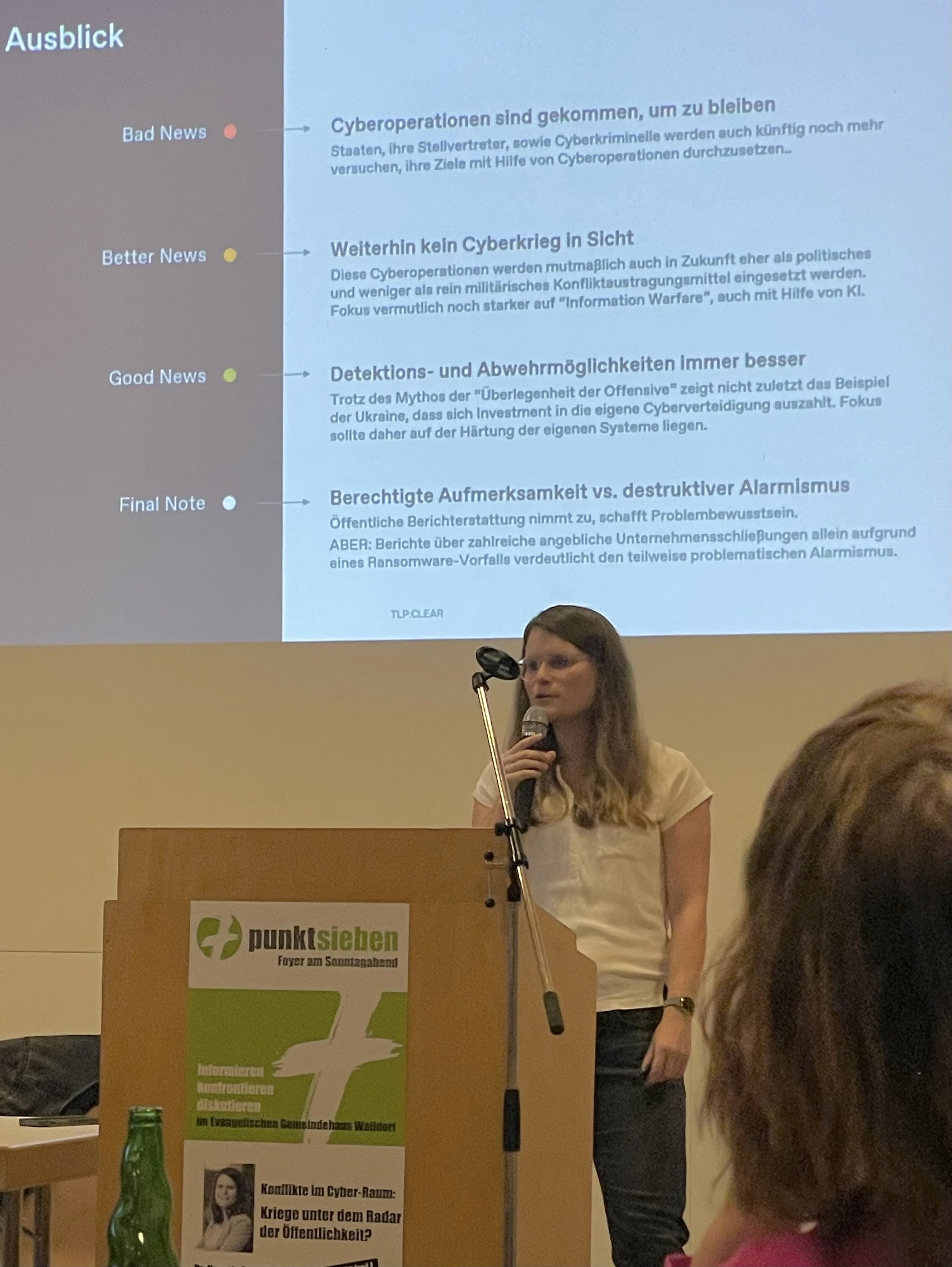Thomas Kemmerer, aus Walldorf stammend, ist Journalist beim Konzern Ippen Media, der ein riesiges Spektrum an Pressearbeit vertritt, von Boulevard-Medien bis zu ernsthaftem investigativem Journalismus. Wenn ein Journalist über Künstliche Intelligenz als Hilfsmittel des Journalismus spricht, dann ist er sich darüber bewusst, dass sich seine von der Pike auf gelernte Arbeit in recht kurzer Zeit verändert: KI übernimmt Aufgaben, die man vorher, sehr zeitaufwendig und mühsam, händisch, in Archiven und vor Ort erledigen musste.
Thomas Kemmerer betonte, dass Journalismus und damit der Erfolg der Pressearbeit in erster Linie mit dem Vertrauen der Leser und Konsumenten zu tun hat. Aber auch mit dem Vertrauen der Gruppen in die Medien, die Gegenstand journalistischer Berichterstattung sind: Politiker etwa oder Wirtschaftsvertreter.
Bei KI sind da zwei Punkte auffällig. Zum ersten gibt es weiterhin Zweifel an der Zuverlässigkeit der Künstlichen Intelligenz. Und zum zweiten hat man Angst, dass Informationen manipuliert werden können. Dies trägt zu einem allgemeinen Vertrauensverlust bei und führt zu Zweifeln an dem ursprünglichen Geschäftsmodell ernsthafter Medien, denn der unabhängig gedachte Journalismus gerät damit unter Druck.
Auf der einen Seite entlastet KI die Redaktionen deutlich. Transkripte von Interviews, die Recherche in den scheinbar unendlichen Archiven des Internets, Foto- und Videobearbeitung und die Produktion von Texten und Artikeln – das alles geht mit KI deutlich schneller und effizienter. Die Frage ist: Bringt und die Datenflut und der leichtere Zugriff auf Informationen einen billigeren Journalismus, insofern Personal eingespart werden kann? Oder bringt es auch einen besseren Journalismus?
Kemmerer sieht drei Kriterien als besonders wichtig für einen besseren Journalismus.
Die Exklusivität von Nachrichten, Gesichtern (Journalisten), die den Gesprächspartnern vertraut sind und die als Fachleute bekannt sind, und die Möglichkeit, nicht nur vom Rechner aus zu recherchieren, sondern tatsächlich dort zu sein, wo die Informationen entstehen, nämlich vor Ort.
Je verständlicher und überschaubarer Informationen für die Leser:innen und Konsument:innen sind, desto besser können sie beurteilen, ob die Infos faktisch richtig sind und ob sie relevant sind für die Zielgruppe. Je lokaler, desto größer ist das Vertrauen in die Medien.
Kemmerer stellte sich nach dem Vortrag noch den Fragen des Publikums. Man machte sich Sorgen darum, wie es weitergeht. Welchen Medien kann man noch trauen? Wo gibt es noch echten Journalismus, der nicht tendenziöse Meinung bilden will, sondern versucht, objektiv Bericht zu erstatten? Und wie sieht die Zukunft wirklich aus, mit einer von TikTok und anderen digitalen Medien geprägten Jugend, die die Informations-Konsumenten der Zukunft sein werden?
Dass das Thema hochaktuell ist, zeigte die stattliche Zuhörerschar von knapp 100 Menschen, die dem Vortrag lauschten und dann engagiert mitdachten und -diskutierten.